Aktuelle Neuerscheinungen aus dem ÖGB-Verlag
Zweimal jährlich gibt der ÖGB-Verlag mit seiner Novitätenbroschüre einen Überblick über aktuelle sowie zukünftige Buch-Neuerscheinungen. In Form dieser Broschüre, in welcher die neuen Bücher des ÖGB-Verlags vorgestellt werden, möchte der…


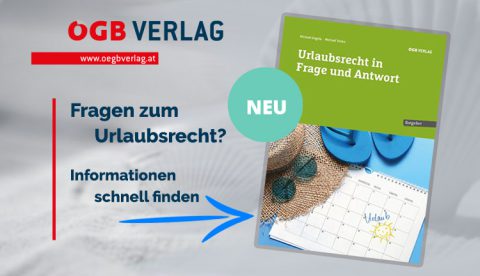
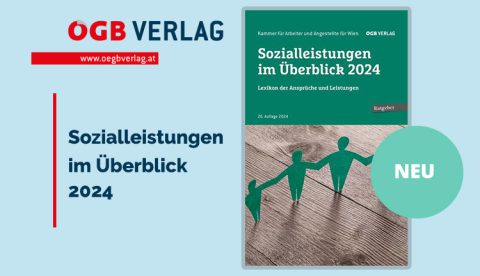







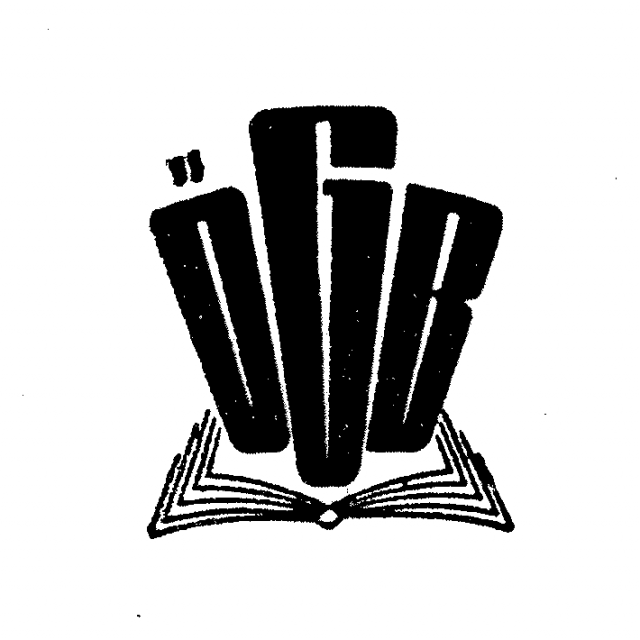 Die Zeiten ändern sich, unser Wertesystem nicht: Gegründet am 17. September 1947 schlägt unser Herz seit jeher für die Interessen der ArbeitnehmerInnen. Die Initiative zur Gründung ging vom damaligen Pressereferenten des ÖGB,
Die Zeiten ändern sich, unser Wertesystem nicht: Gegründet am 17. September 1947 schlägt unser Herz seit jeher für die Interessen der ArbeitnehmerInnen. Die Initiative zur Gründung ging vom damaligen Pressereferenten des ÖGB,